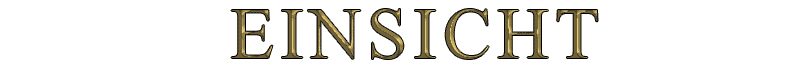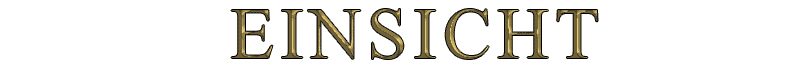1. Mitteilungen der Redaktion
2. Meine Begegnung mit S.E. Erzbischof Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
3. My Time with His Excellency, Archbishop Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
4. Ma rencontre avec S.E. Mgr. Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
5. Mi encuentro con Su Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
6. Il mio incontro con S.E. l´Arcivescovo Pierre Martin Ngô-dinh-Thuc
7. DECLARATIO
|
| Chalcedon, Maximus Confessor und die Hyopstatische Union |
| |
Chalcedon, Maximus Confessor
und die Hyopstatische Union
Teil 3
von
Dr. Ante Krizic
Chalcedon brauchte 200 Jahre, um sich selbst durchzureflektieren. Maximus der Bekenner (geb. 580) hat wie keiner der Väter vor ihm mit aller Entschiedenheit die Lehre, in Christus sind zwei Naturen, bis zu ihren letzten Konsequenzen vertreten, und das menschliche Wollen Christi gegenüber dem göttlichen zu einer vollen Geltung gebracht.
Nicht nur das! Das Geniale an ihm ist, dass er laut Balthasar sechs scheinbar unter sich beziehungslos gewordene geistige Welten in sich selber gegeneinander zu öffnen vermochte und aus jeder ein Licht zu gewinnen verstand, das alle übrigen erhellt und in neue Zusammenhänge rückt. Er ist kontemplativer Bibeltheologe, aristotelisch gebildeter Philosoph. Er war Grieche mit ausgezeichneten Kenntnissen der gesamten griechischen Philosophie, Aristotelismus und Chalcedon bildeten bei ihm einen unzertrennlichen Bund, denn sie wahren die Rechte der Natur gegenüber einem übertriebenen Supranaturalismus. In diesem Sinne ist er ein direkter Vorläufer von Thomas von Aquin.
Maximus war auch ein Mystiker in der großen neuplatonischen Tradition des Nysseners und des Pseudo-Areopagiten, begeisterter Logostheologe in der Nachfolge von Origenes, asketischer Mönch evagrianischer Tradition und vor allem kirchlicher Vorkämpfer und Märtyrer der chalcedonischen Christologie in einer römisch zentrierten Kirche. Man kann sagen, Chalcedon ist die griechisch-römische Blüte des jahrhundertelangen Ringens um die wahre Erkenntnis über Jesus Christus….
Obwohl Cyrill von Alexandrien der Schöpfer der Mia-Physis-Formel war, hat er auch maßgebenden Anteil an der Definition von Chalcedon 451 und zwar durch synodal anerkannte Briefe, den zu Ephesus approbierten zweiten Brief an Nestorius und den Laetentur-Brief von 433. So wird er auch als Zeuge der Zwei-Naturen-Sprache angerufen. Maximus begründet das so: Wenn Cyrill von „einer gemeinsamen, durch beides sich kundgebenden Energie“ spricht, so ist ihr Sinn folgender: Christus ist von Ewigkeit her und auch seit der Menschwerdung im Besitze der Energie der Gottheit, ebenso wie der Vater, und zwar ist diese Energie vor wie nach der Menschwerdung an sich dieselbe. Aber diese göttliche Energie tritt seit der Menschwerdung in anderer Weise zutage. Sie tritt in der innigsten Vereinigung mit der Energie des Fleisches. Wenn er Tote erweckt, Kranke heilt, Brote vermehrt, so tat er das in der Kraft der Gottheit, aber mittels der Menschheit und ihrer Energie.
Er knüpft seine göttliche Kraft an menschliche Handlungen an, z.B. an Ausstrecken und Berühren mit den Händen, das Bestreichen mit Speichel, das Brechen des Brotes. Die Wunderkraft, die naturgemäß der Gottheit zukommt, geht nun auf die Menschheit über und wird ihr Eigentum. So ist die Menschheit Mitwirkerin der Gottheit, sie ist ihr Werkzeug, indem sie die Kraft und Energie der Gottheit hinüberleitet auf das Objekt des Wirkens, wie die Seele sich des Leibes bedient, um ihre Tätigkeit zu entfalten. Allerdings, fährt Maximus fort, betont Cyrill ebenso entschieden, dass der menschliche Natur die Wunderkraft nicht von Natur aus zukommt, sondern nur durch Gnade. So schreibt Cyrill in seinem Kommentar zu Matthäus, darum sagt Christus, er wirke im Geiste Gottes…Wenn es nicht so wäre, dann könnte jede menschliche Natur Wunder bewirken.
Aber in der Zeit vor Maximus hat die cyrillisch-severianisch-alexandrinische Christologie und Weltanschauung nach der Verurteilung der Drei Kapitel (s. Teil 2) über Nestorius und das antiochenische Denken gesiegt und hier schon war die geistige Macht in einem folgenschweren Bund mit politischer Macht getreten. Im Zeichen Cyrills härtete sich die alexandrinische Front zum Monophysitismus. Er wurde sozusagen zum Verhängnis der Ostkirche bis in die heutige Zeit. Viele behaupten, es sei nur ein verbaler Monophysitismus und dass er mit Mia-Physis oder mit mia-hypostasis-synthetos sachlich genau dasselbe meint wie Chalcedon. Es bleibt trotzdem dieser scharfe Gegensatz zwischen Gott und Geschöpf und dieser Gegensatz macht die Quintessenz des asiatischen Denkens überhaupt aus: Die Einheit zwischen Gott und Mensch ist nicht möglich, gleichgültig ob man sie in der Natur oder in der Person sucht. Der Monotheletismus war die letzte Blüte dieses Denkens.
Der Nestorianismus hat sich an die Ostgrenze des Reiches und nach Persien gezogen. Ihm wurde alles Böse zugeschrieben. Durch die Dreikapitel-Verurteilung auf dem fünften Konzil (553), das die Antiochener aufgrund äußerst zweifelhafter und gefälschter Texte verurteilte, der Widerspruch zwischen den beiden päpstlichen Äusserungen, dem abgewogenen Constitutum (14. Mai. 553) und dem erzwungenen Judicatum (554) lassen dieses ganze Geschehen in einem geradezu tragischen Licht erscheinen. Kaiser Justinian hat den Höhepunkt seines religiös-politischen Integralismus erreicht. Das freie Denken war ausgeschaltet, die christliche Theologie war völlig erlahmt. Die theologische Mitte hieß jetzt „Neuchalcedonismus“, eine Richtung, die bis Maximus vorherrschend war. Sie war ein Versuch, um dem Monophysitismus den Wind aus den Segeln zu nehmen, den integralen Cyrill, der durch die apollinarischen Fälschungen übersteigert und belastest war, wieder mit Chalcedon zu versöhnen. Dann tauchte auch ein Mann namens Dionysius Pseudo-Areopag auf, der die freien Geister um sich versammelte.
Der hl. Maximus aber war der Denker, der die Lehre des Pseudo-Areopagiten geläutert und geklärt und sie gewissermaßen für die späteren christlichen Mystiker und auch für die offizielle kirchliche Theologie zubereitet hat. Dazu nahm er auch Origenes und die Kappadokier Gregor von Nazianz und auch Gregor von Nyssa. In seinem Werk „Erklärung dunkler Stellen bei Dionysius und Gregor“ schaffte er es auch eine konstruktive Kritik an Origenes zu üben und so hat er es zustande gebracht in den „Gnostischen Centurien“ ihn in das wahre christliche Erbe zu integrieren. Es ist in der Geistesgeschichte das einzigartige Beispiel, dass man sich über die praktische Verurteilung hinwegsetzte und das geistig Versäumte, das praktisch niedergeschlagen wurde, wieder ins rechte Licht rücken konnte.
Neben Origenes hat Maximus auch dessen Jünger Evragius Ponticus (+ 399) als hervorragende und bestimmende Gestalt des damaligen Mönchstums in die christliche Gesamttradition assimiliert. Mit Evragius hat Maximus in den „Centurien der Liebe“ und an vielen anderen Stellen ebenso unerbittlich gerungen wie mit Origenes in „Ambigua“ und in den „Gnostischen Centurien“. Aber es fehlte noch ein wichtiger Baum, der durch Verurteilung des Nestorianismus entwurzelt wurde: Antiochien.
Die philosophisch-theologische Aufgabe war es jetzt, die Menschennatur Christi zu vertreten, die das eigentliche Anliegen der Antiochener war. Die Menschennatur ist bei den Monotheleten (d.h. Monophysiten) nur ein passiv-gefügiges Werkzeug für den göttlichen Logos zur Verwirklichung seines Weltplanes. Maximus ist es gelungen plausibel zu machen, dass die menschliche Natur in Christus ein eigenes, aktives menschliches Wirken und Wollen besitzt, so dass dadurch nicht nur das Anliegen Antiochiens triumphierte, sondern auch dem Denken Asiens eine andere Sinnrichtung erschlossen wurde. Diesem Heiligen ist es tatsächlich gelungen den Gegensatz zwischen östlichem und westlich-griechischen Denken zu versöhnen: den Gegensatz zwischen östlich-impersonaler religiöser Grundhaltung und biblisch-personalem Offenbarungsdenken, d.h. zwischen Naturreligion und Religion von personaler Begegnung zwischen Gott und Mensch. Und damit auch den Gegensatz zwischen Mythos und Logos, indem die Frage geklärt wurde, was vom Mythos in den Logos hineingeholt werden kann.
In diesem Bezugsrahmen ist Aristoteles der Dreh- und Angelpunkt des westlich-griechischen Denkens, der Osten hat ein ähnliches Gegenstück nicht. Und schließlich den Gegensatz Ost-West in der Kirche Christi. Unter dem dreifachen Primat des philosophischen Logos, des biblischen Christus und des römischen Mittelpunktes bringt Maximus die Fülle Asiens mit. Die Fülle Asiens war vorhanden bei Origenes, der die Fülle der Bibel auf asiatischem Hintergrund einzeichnete: der höchste Gott ist nur Einer, materielle Weltschöpfung ist als Abfall der Ur-Henade der Geister von Gott zu betrachten. Von der Bibel hat er die Dreifaltigkeitslehre, aber Subordination des Sohnes unter den Vater. Aber er war ein glühender Christ. Sein Schüler Evragios vollzieht eine konsequente Askese und Mystik im asiatischen Stil: durch Stilllegung der sinnlichen Vorstellungen und begrifflichen Gedanken, durch Ausschaltung aller Formen im Geist will er das formlose innere Licht des Geistes erreichen, worin das Gott-licht transparent anschaubar wird. Eine Praktik, die bis zum heutigen Tag im östlichen Christentum unter dem Namen Hesychasmus eine ausschlag- und richtunggebende Rolle spielt.
Und schließlich die Fülle Asiens hat ihren Niederschlag auch in der alexandrinischen Christologie gefunden, im Sinne des Logos-Sarx und der Mia-Physis-Lehre des hl.Cyrill, die in Severus erstarrt und durch kein dogmatisches Entgegenkommen mehr zu erschüttern war. Ein Stolperstein, der bis heute die Ostkirche spaltet. Auf dem Boden einer Philosophie des kreatürlichen Seins begegnen und durchdringen sich die drei alexandrinisch-platonischen Theologien: Origenes, Evragius, Dionysius. Im Hintergrund taucht auch Philon von Alexandrien (s. Teil 1) auf. Neben Gregor von Nazianz waren sie tragende Pfeiler in Zeiten des Untergangs, sie tauchen aus der Vergangenheit auf, um die Zukunft zu retten.
Maximus hat die Gesamtgestalt der griechisch-christlichen Überlieferung den verzerrenden Fängen des politischen Integralismus entrissen, er hat die Quintessenz der unverstellten, integralen Tradition des christlichen Ostens bewahrt und herausgestellt, um mit all diesen wiedergewonnenen Schätzen nach Rom zu gehen, sie Rom zugute kommen zu lassen. Und Rom ist, wie sich immer wieder zeigte, nicht zufälliger, politischer Freiheitsort, sondern der Hüter des ausgewogenen evangelischen Glaubens, gegen gnostisch-esoterischen Überwucherungen und Verzerrungen, mit denen die Orientalen ihr Unwesen trieben. Maximus war der erste Orientale, der seinen geistigen Wohnsitz in Rom aufgeschlagen hat. Dieser Heilige hat als Denker zwischen Ost und West vom Christusmysterium her die Ganzheit christlicher Schau gesichtet. Der elementare Weg auf asiatische Weise ist der Weg des Weltentsagens. Denn diese Welt ist vergänglich und sie ist nur Abfall von der ursprünglichen Einheit Gottes. Das zeitlich-räumlich schicksalsergebene Dasein ist also sicher nicht Gott. Um Gott näher zu kommen, muss das Ich ausgelöscht werden. In diesem Sinne kann Menschwerdung Gottes nur dies heißen: Abstieg Gottes ins Viele, Vergängliche und Materielle, um die Vielheit ins Eine zurückzuholen.
Demgegenüber steht im Westen die Bibel, die griechische Philosophie und Rom. Die Bibel mit dem unauflösbaren Gegenüber von Gott und Geschöpf, für das nicht Emanation und Abfall steht, sondern der gute und freie Schöpferwille, der seine letzte Grundlage in der innergöttlichen Trinität der Personen in der Einheit hat. Des weiteren die griechische Philosophie im aristotelisch-stoischen Ernst-nehmen des einzelnen Seienden mit seinem Sinngehalt, und dies als Epiphanie des weltimmanenten göttlichen Logos. Rom endlich, als der Ort der Rechte und Ordnung, der auf allen Gebieten die Verwirrungen trennend durchklärt und in die passende Kategorie einordnet. Und nun zwischen diesen Gegenpositionen und scheinbaren Widersprüchen kommt das Chalcedon: Gott und Mensch in einem, ungetrennt, aber unvermischt! Das Zauberwort für die Versöhnung all dieser Gegensätze heißt Synthesis, ein Begriff, den Maximus von Leontius von Jerusalem übernommen hat (s. Teil 2).
Der höchste Fall der Synthesis ist in Christus zu sehen, der den unendlichen Abgrund zwischen Gott und Geschöpf ohne Vermischung der Naturen schließt. Vollkommen wird also der Eingang der Welt in Gott erst durch die Menschwerdung Gottes und die in ihr verwirklichte hypostatische Einigung der geschaffenen und ungeschaffenen Natur, in der beide Einheit und Differenz bilden. Die christologische Formel von Chalcedon wird für Maximus zu einem Grundgesetz der Metaphysik. Alle Dinge sind eingeordnet in immer umgreifendere Synthesen, ja sie sind selber Synthesen im Hinblick auf die letzte, alles rechtfertigende Synthesis Christi hin.
Die Einigung von Gott und Welt, Ewig und Zeitlich, Unendlich und Endlich, Gnade und Natur, Himmel und Erde sind in der Hypostase eines einzigen Wesens, ungetrennt und unvermischt verborgen: des Gottmenschen. Das ist die Lösung aller metaphysischen Welträtsel: Chalcedon als Weltformel (Balthasar). Die Synthesis von Gott und Welt ist ein Gottes Gedanke und sie kann nur durch einen völlig transzendenten Eingriff Gottes erfolgen. Dass die Menschwerdung Gottes, ja das Drama von Kreuz, Grab und Auferstehung nicht nur der Mittelpunkt der Weltgeschichte, sondern die grundlegende Weltidee ist, sagt Maximus ausdrücklich in seinen „Quaestiones ad Thalassium“. Für unseren Alltag heißt es: freiwilliges und bewusstes Absterben von unseren Begierden, um damit Sieg über den Tod durch Vorausnahme des Todes selbst in der Nachfolge Christi zu vollziehen.
Im einzelnen behandelt Maximus fünf große Synthesen, die zur Einheit führen: Christus „eint den Mann und die Frau,...die Erde durch Aufhebung der Trennung zwischen dem irdischen Paradies und dem übrigen bewohnten Erdkreis,...die Erde und den Himmel,...die sinnlichen und die intelligiblen Dinge,… und schließlich auf unaussprechliche Weise die geschaffene und die ungeschaffene Natur.“ So steht es in seinen „Quaestiones ad Thalassium“. Darüber hinaus gibt es bei ihm ein ganzes Geflecht der geistlichen Synthesen, und es ist unmöglich, sie alle anzuführen und zu analysieren. Es genügt, wenn man die Frage nach dem Wesen der Synthesis und damit auch das Wesen der Transzendenz einigermaßen klärt. Die christologische Synthese ist der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Synthese, so dass sie zum allgemeinsten Gesetz des Seins wird. Warum wollten wir sie nicht annehmen „da wir doch eine so große Anzahl von Synthesen kennen, in denen die Pole sich unzertrennlich vereinigen, ohne doch die geringste Umwandlung ineinander oder Veränderung zu erleiden?“, schreibt Maximus in seinem 12. Brief.
Dieses allgemeinste Seinsgesetz lautet wie folgt: „Jede Ganzheit, und vornehmlich die aus der Synthesis verschiedener Elemente sich ergebende, trägt bei einheitlicher Wahrung ihrer hypostatischen Identität, zugleich die unvermischte gegenseitige Verschiedenheit ihrer integrierenden Teile in sich, dergemäss sie den wesentlichen Bestand jedes Gliedes in seiner Beziehung auf das andere erhält. Die Teile hinwiederum bewahren, bei unvermengter, unverminderter Erhaltung ihres naturhaften Bestandes in der gegenseitiger Synthesis, die eins-förmige Identität ihrer eigenen Ganzheit, dergemäss sie in völliger Unzertrennlichkeit den einheitlichen hypostatischen Bestand erhalten.“ (So aus dem 13. Brief. Nebenbei bemerkt: Maximus, wie es auch in der damaligen Zeit üblich war, hat jedem Ding eine Hypostase zugeschrieben). Das Mysterium der Gegenwart einer Totalität in ihren Teilen, aus deren Synthesis diese Totalität resultiert, ist für Maximus keine interesselose Spekulation. Es ist für ihn der gerade Weg zu Gott. Wenn die Glieder der Synthesis innerhalb der Einheit selbst differenziert sind, dann ist Gott selbst letztlich die höchste Synthesis, in der alle Differenz sich bildet und wieder auflöst. In seinem Kommentar zu Dionysius‘ Werk über die Göttlichen Namen schreibt er: „Er, der allein der Denkgedanke der Denkenden wie der Gedachten, das Wort der Sprechenden wie der Gesprochenen, das Leben der Lebenden wie der Gelebten ist.“
Wenn die Glieder untereinander nur verkehren können durch die Einheit ihrer Totalität, dann können sich die Geschöpfe als solche nur durch ihre transzendente Identität in der Einheit Gottes zueinander öffnen. Es ist eine negative Identität, sofern sie alle das eine Nichts in Bezug auf ihren Ursprung sind und von daher die Grundeigenschaft haben, nicht Gott zu sein. Es ist aber auch eine positive Identität, insofern der eine Schöpfer sie durch seine Beziehung zu ihnen im Dasein erhält. Die unbegreifliche Fruchtbarkeit der göttlichen Einheit liegt darin, dass sie einerseits die Ursache der Einzigkeit aller Dinge in ihrer gegenseitigen Verschiedenheit, die jedes von ihnen zu einem Abbild der göttlichen Einheit und Einzigkeit macht, der Grund also ihres unmittelbaren Daseins und zugleich der ermöglichende Grund ihrer Gemeinschaft und liebenden Kommunikation ist. Das ist das Paradox, nicht der Widerspruch der Synthese, dass sie eint, indem sie trennt, und trennt, indem sie eint, ein Paradox, das den gesamten Aufbau der Welt durchzieht.
Es ergibt sich von selbst die Einsicht, dass das Analogiedenken seine Wurzeln in dieser Ontologie hat. So wundert es nicht, wenn man sagt, was „cogito ergo sum“ für die profane Philosophie bedeutet, das ist für die katholische Philosophie die Analogia entis. Die Ganzheit ist also aus Teilen, in den Teilen und durch die Teile. Damit ist schließlich auch die Beziehung des Ganzen zu den Teilen gleichwertig der Beziehung der Teile untereinander. In dem erwähnten Kommentar schreibt er weiter „Denn es ist das Gesetz Gottes,...(dass er) die einzelnen Teile des Alls in sich selbst und ineinander unvermischt und ungeschieden erhält und sie durch die einheitsstiftende Beziehung mehr füreinander als für-sich-selbst lässt.“
Hier offenbart sich der Sinn der Hypostase als eines Mediums, das zwar die Naturen in sich selbst wie eine Brücke verbindet, hält sie aber ebenso auseinander. Diese archetypische Form des Mediums, das paradoxerweise die Kluft zwischen zwei Polen zugleich aufbricht, offen hält und überwindet. Man kann es als eine Umschlagstelle, eine Art Transformationsschleife, etwa wie Möbius-Band bezeichnen. Der Vergleich hinkt sehr, kann aber trotzdem einigermaßen als Verständnisstütze fungieren. Maximus Texte suggerieren auch eine Ähnlichkeit mit Hegel, aber von Hegel trennt ihn ein Abgrund. Maximus hat gerade in der Christologie alle Sorgfalt darauf verwendet, jeden echten Widerspruch und damit jede adventslose Dialektik und Dämonie aus dem Dasein und Wesen Christi fernzuhalten. Wieder zeigt sich, wie die Christologie in ihrer Sekularisierung zur Dialektik führt, in ihrer theologisch genuinen Gestalt aber die Dialektik überwindet. So hat es zutreffend Erich Przywara in seiner „Analogia entis“ gesagt, es sei „...zu beobachten, wie die absoluten Philosophien der Neuzeit auch geschichtlich tatsächlich ent-theologisierte Theologien sind.“
Bei Hegel begründet der Kampf selbst die Synthese, bei Maximus bleibt alles aufgehängt an einem vorgängigen, souveränen und freien Akt der Person. Das Hauptgewicht liegt bei Maximus auf dem letzten hypostatischen Seinspunkt, wo Freiheit, Liebe und Sein zusammenfallen. Die höchste Paradoxie eines hypostatischen Freiheitspunktes ist die Freiheit der Liebe, die gleichsam jenseits aller Naturen liegt. Maximus wird nicht müde, immer wieder zu betonen, auch dann und gerade dann, wenn die Wogen des Neides und Verleumdung gegen ihn selbst hochgehen, dass die Liebe die Quintessenz der Hypostase ist, sie ist jene „Transformationsschleife“ - und nicht der Widerspruch wie bei Hegel –, die die Welt zusammenhält und ihr auch den Sinn verleiht.
Christus hat uns „mehr geliebt als sich selbst“, da er die Dunkelheit der Menschwerdung seinem Leben im göttlichen Ur-licht vorzog. Dieses Vorweg der Liebe wurde durch die Inkarnation zum Maß und Gesetz jeder Liebe in dieser Welt, und nach ihr hat sich die unsere zu formen. Bei Hegel ist die Mitte gebrochen, die Hypostase, das Medium fehlt, es bleibt bloß der Kampf der Gegensätze, der zu Widersprüchen führt. Den Widerspruch hat Hegel konsequenterweise eben deswegen zur Triebfeder allen Geschehens gemacht. Diese gebrochene Mitte ist bei ihm eine Konstante, unabhängig davon, ob sich der jeweilige Text auf den Kampf innerhalb der Natur oder innerhalb des Subjektes bezieht. Damit es nicht so aussieht, als ob es nur pauschale Urteile und plakative Verurteilungen wären, hier einige Kostproben. Zuerst ein Zitat aus seinem Artikel über das Verhältnis von „Herrschaft und Knechtschaft“, wo es um den Kampf auf der Ebene des Subjektes geht, mit der beliebigen Austauschbarkeit der Argumente seitens beider Subjekte:
„Aber, das Andere ist auch ein Selbstbewusstsein; es tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf. So unmittelbar auftretend, sind sie füreinander in der Weise gemeiner Gegenstände, selbstständige Gestalten, in das Sein des Lebens – denn als Leben hat sich hier der seiende Gegenstand bestimmt – versenkte Bewusstseine, welche füreinander die Bewegung der absoluten Abstraktion, alles unmittelbare Sein zu vertilgen und nur das rein negative Sein des sichselbstgleichen Bewusstseins zu sein, noch nicht vollbracht, oder sich einander noch nicht als reines Fürsichsein, d.h. als Selbstbewusstsein dargestellt haben. Jeder ist wohl seiner selbst gewiss, aber nicht des anderen, und darum hat seine eigene Gewissheit von sich noch keine Wahrheit; denn seine Wahrheit wäre nur, dass sein eigenes Fürsichsein sich ihm als selbstständiger Gegenstand, oder, was dasselbe ist, der Gegenstand sich als diese reine Gewissheit seiner selbst dargestellt hätte.“ Und hier ein Zitat aus seiner „Religionsphilosophie“ über den Kampf innerhalb der Naturen um das „hypostatische“ Ich: „Die beiden Extreme sind jedes selbst Ich, das Beziehende und das Zusammenhalten, Beziehen ist selbst dies in Einem sich Bekämpfende und dies im Kampf sich Einende. Oder: Ich bin der Kampf, denn der Kampf ist eben dieser Widerstreit, der nicht Gleichgültigkeit der Beiden als Verschiedener, sondern das Zusammengebundensein beider ist. Ich bin nicht einer der im Kampf Begriffenen, sonder ich bin beide Kämpfer und der Kampf selbst. Ich bin das Feuer und das Wasser, und die Berührung und Einheit dessen, was sich schlechthin flieht.“
In der Synthese von Maximus sind die Naturen nicht das Feuer und das Wasser und die Einheit dessen, was sich schlechthin flieht, sondern die Einigung der Pole vollzieht sich in dem gleichen Masse, als ihre wahrhafte Verschiedenheit gewahrt bleibt. Die gegenseitige Verschiedenheit der Pole wird unterstrichen und gefestigt. Und das große Wort von Chalcedon hieß: Wahrung der Eigentümlichkeiten beider Naturen. So auch in der Christologie von Maximus: in ihr bot die unvermischte Wahrung der beiden Naturen – der göttlichen und der menschlichen – das Fundament für die entscheidende Synthese. Diese unvermischte Wahrung der menschlichen Natur in Christus setzte sie allein imstande, all ihren positiven Gehalt unvermindert der Einigung zur Verfügung zu stellen, als Baustein für die große Brücke zwischen Gott und Welt. Nur wenn Christus seine volle Verwandtschaft mit dem göttlichen Vater und der menschlichen Mutter bewahrt, ist er „völlig wesensgleich den Dingen droben und den Dingen drunten.“ So schreibt er in seinen „Opuscula theologica et polemica“. In der Hypostase Christi ist eine „strenge Selbigkeit“ beider erreicht, die in den Naturen ein lebendiges Durchdringen und Durchwachsen, - und hier gebraucht Maximus das Wort Perichorese – einen gegenseitigen Austausch von Eigenschaften, wie sie zwischen dem Feuer und dem darin glühenden Eisen besteht. Die Hypostase ist also das Medium, von dem wir sprachen, sie verbindet die Naturen in sich selber, hält sie aber ebenso auseinander (s. Vergleich mit Möbius-Band), so dass nur eine indirekte Prädikation der einen Natureigenschaften von der anderen möglich ist. Sie ist das Dritte, aber nicht in dem Sinne das Dritte, dass das Sein der Hypostase gegenüber der Naturen steht, sondern die Hypostase ist eins mit dem göttlichen Sein und ihm immanent und kraft dieser Einheit des Seins hat die Menschennatur hypostatische Existenz. Denn die Kenosis Gottes ist jene „unendliche Macht“, die zugleich Freiheit und Liebe ist und die es Gott ermöglicht „durch eine unendliche Sehnsucht nach dem Menschen selbst in aller Wahrheit und physisch der Gegenstand seines Begehrens zu werden.“ So steht es in seiner Ambigua (Erklärung dunkler Stellen bei Gregor von Nazianz und Dionysius).
Die Lehre, dass die Ganzheit aus Teilen, in den Teilen und durch die Teile besteht, wobei die Teile ihre Individualität bewahren, und dass bei ihnen gegenseitige Durchdringung herrscht, wird von vielen modernen Theologe im Westen heutzutage als unverständlich, ja sogar als „schizophrene“ Spekulation abgetan. Diese Denkfigur ist aber auch in anderen Kulturen bekannt und genießt volle Anerkennung. Dazu ein Beispiel: Pan-Chiu Lai, ein christlicher Gelehrter in Hongkong, schreibt in seiner Abhandlung „Trinitarische Perichorese und Hua-Yen Buddhismus“, dass diese buddhistische Richtung eine Theorie der wechselseitigen Identität und der wechselseitigen Durchdringung vertritt, die auf der Lehre des abhängigen Ursprungs und der Lehre der Leerheit (sunvata) basiert. Sie bezieht sich auf den Aspekt der Beziehung zwischen unterschiedlichen Relata, d.h. auf die Art und Weise, in der unterschiedliche Dharmas wechselseitig identisch und sich wechselseitig durchdringend sind.
Damit wird jedoch nicht die andere Ansicht der Nicht-Bezogenheit geleugnet, die betont, dass jedes individuelle Dharma seinen eigenen Wert besitzt. Es geht nicht um die Identifikation eines Phänomens mit einem anderen Phänomen, sondern eher um eine Identifikation auf der Ebene des Dazwischen-Seins. Zwei verschiedene Gegenstände sind identisch in der funktionellen Identität ihres Dazwischen-Seins, dennoch ist der eine Gegenstand nicht identisch mit dem Anderen. Das Ganze ist nicht vom Teil getrennt, weder ist es diesem vorgängig noch wichtiger als dieses, jedes Teil ist notwendig für das Ganze. Um das Ganze wertzuschätzen und zu ehren, ist das Teil wertzuschätzen und zu ehren… Diese Auffassung ist natürlich keineswegs deckungsgleich mit der christlichen, es sei nur angemerkt, dass man solche Ansichten nicht verhöhnen darf...
Wie aber fasst Maximus die Perichorese auf, zuerst in Bezug auf die Trinität, und dann auf die Christologie? Im Teil 2 ist uns der Begriff „Enhypostaton“ begegnet (s. dazu besonders die Ausführungen von Leontius von Jerusalem) , den man auch mit „einhypostasiert“ übersetzen kann. Dazu gehört auch der Begriff „Enousion“, was so viel wie „einverwesentlicht“ bedeutet. Das Wort Enhypostaton stammt aus dem Neuplatonismus und über Nemesius, den Bischof von Emesa, kam es in die christliche Welt, und besagt, dass eine Ousia als Teil ins Sein einer anderen Ousia eintreten kann, ohne etwas von ihrer eigenen Natur oder Vollkommenheit einzubüßen. Der Neuplatoniker Porphyrius denkt dabei an Leib und Seele des Menschen, die in der Gesamtnatur des Menschen ungeschmälert erhalten bleiben. Dieses Beispiel spielte später eine große Rolle in der Christologie. Maximus benutzt es zuerst in dieser Bedeutung, wenn er vom Logos „enousios“ und „enhypostatos“ des Vaters spricht. Doch meinen diese Begriffe hier nicht nur „real existierend“, sondern vor allem „in die göttliche Wesenheit hinein hypostasiert.“ In seiner Ambigua widerlegt er die Theorie, dass die Einheit der Wesenheit Gottes den der Personen voraus-liege und sich in diese naturhaft entfalte. Vielmehr „ist Einheit das durch-hypostasierte Sein der wesensgleichen Trinität“, so wie gleicherweise die Trinität nicht die Synthesis von drei Einheiten ist, sondern „durchwesentlichte Existenz der drei-hypostasierten Einheit“. An einer anderen Stelle in der Ambigua werden die zweite und dritte Person in Gott homoousios und „enhypostatos“ in der Güte des göttlichen Wesens genannt. „Enhypostatos“ hat also in der Trinität den doppelten Sinn, die durch und durch „verpersönlichte“ Existenzweise des Wesens Gottes und die im Wesen eingewurzelte Existenz der göttlichen Personen.
In der Christologie schränkt er den Sinn noch stärker ein. So wie die Hypostasis Ansich-Sein und Fürsich-Sein bedeuten kann, so auch Enhypostaton, was noch deutlicher wird am Gegensatz Anhypostaton, d.h. Überhaupt-Nichtsein oder In-einem-anderen-Sein, wie z.B. Akzidentien in der Substanz. Die menschliche Natur in Christus ist also hypostaselos, aber sie hat ihr In-Sein in der göttlichen Hypostase. In der „Opuscula theologica et polemica“ schreibt er: „Die Tatsache, nicht Anhypostaton zu sein, schließt noch nicht ein, dass etwas Hypostase sei, so wenig wie daraus, dass kein Körper gestaltlos ist, folgt, dass jeder Körper als solcher Gestalt sei.“ Dieselbe Überlegung stellt sich ein in Bezug auf Enousion in der Wesensordnung. Beide Begriffe sind geeignet den „Raum“ zwischen den „Polen“ Wesen und Person zu erhellen. Dasselbe Einwohnen der Hypostase (Person) in der Natur (Wesen), wodurch die Hypostase „verwesentlicht“ (enousion) wird, lässt die Natur „hypostasiert“ (enhypostaton) werden, ohne dass die Pole dadurch zusammenfallen.
Das Verdienst von Maximus auf diesem Gebiet besteht darin, dass er mit dem damaligen Begriffsinstrumentarium zuerst das Recht der selbstbewussten und freien Natur wiederherstellte und damit erst die Voraussetzung schaffen konnte für ein echtes Denken der Person (Hypostase), insofern sich diese von der ganzen Wesens- d.h. Naturordnung abhebt. Diese beiden Begriffe Enhypostaton und Enousion sind also auch geeignet, jene Stufen und Formen des Seins zu beschreiben, die sich aus der dynamischen Durchdringung der Elemente im Bereich des geschöpflichen Seins ergeben. Maximus gibt in seinem 15. Brief zwei Beispiele aus dem Bereich der geschaffenen Seinsordnung: „Enhypostatisch wird genannt, was niemals für sich selbst besteht, sondern in anderen angetroffen wird, wie etwa die Gattung in den unter sie fallenden Einzelwesen, oder auch, was mit einem anderen Wesensverschiedenen zum Entstehen einer neuen Ganzheit synthetisiert wird. Der Teil unterscheidet sich dann im selben Masse durch seine beschränkenden Merkmale von den Dingen gleicher Gattung im Wesen (z.B. die Menschheit Christi von anderen Menschen), als er sich hypostatisch dem korrespondierenden Teil gleich-gestaltet und eint.“
Beide Möglichkeiten betreffen die gleiche ontologische Situation. Im ersten Beispiel hypostasiert sich eine Gattungswesenheit in ihren naturgemäßen Individuen, die dann eine Einheit bilden. Im zweiten Beispiel hypostasiert sie sich in einer „fremden“ Hypostase und dann sind die individuellen Merkmale (idiome), d.h. jene „wesentlichen“ Eigenschaften, die indirekt die Hypostase offenbaren, auf jene „fremde“ Hypostase zu beziehen. Das gleiche wäre wiederum von enousion zu sagen. Beide Begriffe, die eine Durchdringung (Perichorese) ohne Mischung erlauben, sind der geniale Kerngedanke der Synthese von Maximus Confessor: Eine Einigung ohne Vermischung der Naturen, d.h. ohne Zusammenfall.
Über das Verhältnis von Gottheit und Menschheit in Christus ist sich der heilige Maximus im klaren: Christus ist Gott und Mensch zugleich. Das kann aber nur dann sein, wenn in ihm göttliche und menschliche Natur verbunden sind, zwar in Einheit der Person, aber doch so, dass jede Natur ihre wesentliche Beschaffenheit unversehrt bewahrt. Es sind also im Gottmenschen zwei Naturen und nicht eine, weder eine schlechthin, wie Eutyches sagt, noch eine zusammengesetzte, wie Leib und Seele die eine Menschennatur bilden. Das ist der echte Glaube, der auch durch Chalcedon festgeschrieben wurde. So wie Maximus entschieden eine zusammengesetzte Natur in Christus bekämpft, ebenso verteidigt er energisch eine zusammengesetzte Hypostase in Christus (mia hypostasis synthetos). Die Untersuchungen, die er über die Berechtigung dieser Formel anstellt, sind entsprechend dem obigen Zitat derart, dass er speziell das Verhältnis des Einzelwesens zur Natur in den Kreis der Betrachtung zieht: Die Einzeldinge hängen von der Gattung ab und werden von ihr beherrscht. Er denkt sich das so, dass es am Anfang des Werdens nur eine einzige allgemeine Wesenheit gibt, die keine Merkmale an sich trägt (die viel spätere Seinsphilosophie hat diese „Wesenheit“ esse ipsum non subsistens genannt).
Sie zerteilt sich dann in einzelne Gruppen und konzentriert sich in ihnen. So entstehen viele Wesenheiten (Naturen), die langsam Umrisse bekommen. Der Verdichtungsprozess schreitet immer fort, stets übergehend vom Allgemeinen zum weniger Allgemeinen, vom weniger Bestimmten zum mehr Bestimmten. Die Entwicklung kommt zum Abschluss in dem konkreten, genau formierten Einzelding. Diese Lehre, besagt also, dass die einzelnen Dinge durch Individualisierung entstehen. Das Individuum bezeichnet er sowohl als atomon als auch als Hypostase, allerdings mit einem wesentlichen Unterschied: Hypostase bringt lediglich das Für-sich-sein eines Dinges zum Ausdruck, während atomon immer eine über den Individuen stehende Allgemeinnatur voraussetzt. Die Bezeichnung atomon schließt immer in sich den Gedanken an das Werden des Dinges ein, an seine Entstehung aus allgemeinen Wesenheiten. Ist nun eine Natur für sich schon zusammengesetzt aus mehreren Bestandteilen, wie z.B. die menschliche, so ist sie es auch in ihrer Individualisierung. Jede zusammengesetzte Natur ist also, wenn sie real ist, zusammengesetzte Hypostase.
In der Naturordnung existiert eine Hypostase nur dadurch, dass eine allgemeine Wesenheit real wird. Daraus folgt allerdings, dass jede natürlich zusammengesetzte Hypostase zugleich eine zusammengesetzte Natur ist. Allein diese Tatsächlichkeit in der Ordnung des geschaffenen Seins ist nicht absolute Notwendigkeit. Es lässt sich denken, dass eine Hypostase zusammengesetzt ist, ohne zusammengesetzte Natur zu sein. Und es ist durch Gottes Einwirken Tatsache geworden in Christus. Er ist Hypostasis, konkretes Einzelwesen, und zwar bestehend aus Gottheit und Menschheit, die in ihm aufs innigste verbunden sind. Er ist aber nicht atomon, Träger einer über ihm stehenden Natur. Deswegen müssen wir ihn eine zusammengesetzte Hypostase (mia physis synthetos) nennen, ohne ihn deswegen auch eine zusammengesetzte Natur (mia physis synthetos) nennen zu müssen.
Die Frage ist nun, welchen Stellenwert Maximus den beiden Naturen, besonders der menschlichen, gibt? Findet sich in Christus eine allgemeine oder individuelle menschliche Natur? Natürlich die individuelle! Denn das Wesen (Natur) ist das Allgemeine, es existiert nicht. Die Natur kann nur wirklich sein und werden in den einzelnen Individuen. Die Hypostase ist der Träger und Verwalter der Natur. Sie ist das Besondere von dem das Allgemeine (Natur) ausgesagt wird, das aber selber nicht von anderen ausgesagt wird. Der Begriff der Hypostase umfasst neben dem Merkmal des Individualseins und über dasselbe hinaus auch das des Für-sich-Seins. Eine Natur ist erst dann Hypostase, wenn sie nicht nur individuell, sondern auch für sich ist, d.h. Selbststand hat. Ist auch jede Hypostase eine individuelle Natur, so ist doch nicht jede individuelle Natur eine Hypostase. Die Argumentation dafür haben wir oben bei der Besprechung der Perichorese erörtert. Mit seinen scharfsinnigen Überlegungen und Analysen der Begriffe Enhypostatos und Enousios hat er sowohl den Nestorianern als auch Monophysiten den Wind aus den Segeln genommen. Sie gingen alle von dem gemeinsamen Satz aus: Jede Natur ist Hypostase, da sie nur in einzelnen Dingen existieren kann. Nach Maximus ist das Für-sich-Sein das fundamentale Merkmal einer Hypostase, woraus dann das Individualsein sich von selbst ergibt, nach ihnen dagegen ist zuerst das Individualsein, woraus immer auch das Für-sich-Sein folgt. Nach ihnen ist also das Besondere das Hypostasierende, nach Maximus ist die Hypostase das Individualisierende.
Das durch die Vereinigung von Gottheit und Menschheit zu persönlicher Einheit unter Wahrung des Unterschiedes der Naturen entstandene Wesen trägt den Namen Christus, der ein Personennamen ist. Die Menschheit in Christus existiert nicht durch sich und für sich, sondern nur durch den göttlichen Logos und im Logos. Dadurch ist der Logos zugleich Hypostase der menschlichen Natur. Es ist vor der Inkarnation und nach der Inkarnation eine und dieselbe Hypostase des Logos, nach der Inkarnation allerdings ist sie Inhaberin zweier Naturen. Darum ist jede Vermehrung und Verminderung der Heiligen Dreifaltigkeit durch die Menschwerdung ausgeschlossen.
Christus ist Gott, weil er Träger und Inhaber der göttlichen Natur ist, und er ist auch Mensch, weil er zugleich ebenso wahrhaft und wirklich Träger der menschlichen Natur ist. So nimmt Christus eine ganz singuläre Stellung ein gegenüber Gott und den Menschen, zwar von beiden geschieden durch seine Eigenpersönlichkeit, zugleich aber mit ihnen verbunden als Inhaber göttlicher und menschlicher Natur. So unterscheidet Maximus, sich auf Cyrill berufend, drei Klassen von Aussagen über den Gottmenschen in der Bibel: vorherrschend göttliche, so Joh.10, 30 und 14, 19f; vorherrschend menschliche, so Joh. 8,39 etc.; und eine dritte Klasse, die in der Mitte zwischen beiden steht, so Hebr. 13, 8; 1 Kor.8, 6 und Röm. 9, 5, wo Göttliches und Menschliches zugleich von demselben Christus ausgesagt wird. In der Ambigua erörtert Maximus u. a., in welchem Sinne Gott-Vater als Vater und als Gott Jesu Christi bezeichnet werden müsse. Er sagt: Gott Vater muss beides genannt werden, Gott und Vater Jesu Christ, und zwar sowohl im eigentlichen als auch im uneigentlichen Sinne. Im ersten Fall, wenn man Christus betrachtet mit Rücksicht auf Seine Hypostase. Denn als solcher ist er einer der Heiligen Dreifaltigkeit, und daher ist Gott sein Vater, und ebenso ist Christus einer von uns, und daher ist Gott sein Gott. Beide Bezeichnungen sind aber auch im uneigentlichen Sinne anzuwenden, wenn man nämlich die Naturen in Betracht zieht. Denn Gott ist nicht eigentlich der Gott des Logos und ebenso nicht der Vater des Fleisches.
Diese Klarheit fasst Maximus in einer Formel zusammen: „Solange man die Eine Hypostase Christi im Auge hat, kann man den Namen wechselseitig verbinden. Trennt man aber in Gedanken die beiden Naturen, die die Eine Hypostase Christi bilden, so sind mit den Naturen auch die Namen zu trennen.“ In diesem Falle heißt es dann: „Da Christus doppelt ist bezüglich der Natur, so wird beides von ihm ausgesagt: Gott und Vater, und zwar im eigentlichen Sinne; solange aber die Namen den Naturen entsprechen im uneigentlichen Sinne….“
Hier geht es um communicatio idiomatum (Austausch von Eigenschaften), in der es durchweg als wechselseitige Übertragung der Eigentümlichkeiten der einen Natur auf die andere geht, aber immer in concreto, nicht in abstracto: Christus ist wahrhaft leidender Gott und wahrhaft wunder-wirkender Mensch. Die hypostatische Union bietet ihm die Grundlage für die Lehre vom leidenden Gott. Neben dem Leiden Gottes steht in seinem System gleichsam als Gegenstück die Vergöttlichung der Menschennatur.. Auch diese hat ihre Wurzel in der hypostatischen Union. Die innige Vereinigung der beiden Naturen bewirkt nämlich nicht nur, dass sie neben und an, sondern ineinander sind, sich durchwandern und durchwirken, ein Kreisen der Gottheit in der Menschheit, und ein Kreisen der menschlichen Natur in der göttlichen, was er eben Perichorese nennt und was wir schon kennengelernt haben (Eine beiläufige Bemerkung: Von der Perichorese ausgehend bezüglich der Trinität vertrat Maximus die römische Filioque-Lehre). Aus der hypostatischen Union ergaben sich somit für ihn vier Konsequenzen: 1. Perichorese, 2.Communicatio idiomatum, 3.Sündenlosigkeit Christi und 4. Muttergotteswürde Mariens.
Nun untersucht Maximus die Wirksamkeit jeder Natur, speziell die der menschlichen. Der Monophysitismus mit seiner Lehre, in Christus gebe es nur eine göttliche Natur mit einer Wirkkraft und einem Willen, hatte ein gefährliches Nachspiel – den Momotheletismus. Sophronius, der spätere Patriarch von Jerusalem (634) und erste Angreifer der monotheletischen Irrlehre, war derjenige, der Maximus auf diese Gefahr aufmerksam machte. Maximus bekämpfte dann diese Häresie mit der durchdachten Überzeugung seines Glaubens und mit der Kraft seiner intellektuellen Überlegenheit. Er analysiert akribisch die menschliche Natur mit ihrem eigenständigen Willen und findet auch zahlreiche Stellen in der Bibel, die zwei Willen in Christus, einen menschlichen und einen göttlichen eindeutig bestätigen. Hier einige Beispiele für den menschlichen Willen: „Und sie gaben ihm Essig mit Galle gemischt zu trinken, und nachdem er es gekostet hatte, wollte er nicht trinken“ (Matth. 27, 34); „Um die vierte Nachtstunde kam er zu ihnen, wandelnd auf dem Meere, und er wollte an ihnen vorübergehen“ (Mk. 6, 48); „Und von da machte er sich auf und ging in das Gebiet von Tyrus und Sidon, und da er in ein Haus eingetreten war, wollte er, dass es niemand wisse und er konnte nicht verborgen bleiben“ (Mk. 7, 24); „Tags darauf wollte er nach Galiläa gehen“ (Joh. 1, 43); „Von da gingen sie nach Galiläa, denn er wollte nicht, dass es jemand wisse“ (Mk. 9, 29).
Wenn Paulus sagt „Er war gehorsam bis zum Tode, bis zum Tode am Kreuz“ (Phil. 2, 8), so kann es wiederum nur von Christus gesagt werden, insofern er Mensch ist ,denn als Gott ist er weder gehorsam noch ungehorsam. Gehorsam ist aber nur da möglich, wo freier menschlicher Wille vorhanden ist. Ebenso spricht die Schrift vom göttlichen Wirken und Wollen des Herrn, so z.B.: „Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt werden, wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt unter ihre Flügel, du aber hast nicht gewollt“ (Matth. 23, 37); „Gleichwie der Vater die Toten erweckt und lebendig macht, welche er will, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will“ (Joh. 5, 21) etc., etc... Entsprechend besitzt Christus neben dem freien göttlichen auch einen freien menschlichen Willen. Das ist die Lehre der Vernunft und auch die Lehre der Väter, wobei Maximus viele Beispiele auch dafür anführt. Am deutlichsten sprachen sich Athanasius und Gregor von Nyssa aus, indem sie genau unterscheiden zwischen dem, was dem menschlichen, und dem, was dem göttlichen Willen zukommt.
Ein eindeutiger Beweis für das Vorhandensein von zwei Willen in Christus ist das Gebet Christi am Ölberg. Der Ölberggarten, wo sich in einer einzelnen Seele das kosmische Ringen zwischen Gottnatur und Weltnatur vollzieht, ist nicht nur der Mittelpunkt des Werkes Christi, sondern auch der Kern aller Synthesen (Balthasar). Christus spricht als Mensch und offenbart seinen menschlichen Willen. Aber in ihm tritt auch die andere Seite hervor. In den Worten „Vater, wenn es möglich ist, möge dieser Kelch an mir vorübergehen“ spricht er die Furcht vor dem Tode aus und bittet um seine Abwendung. Er bekundet seinen Willen als den eines natürlichen Menschen und beweist so die Wahrheit und Wirklichkeit der Menschheit und der Erlösung, frei von jeder Vortäuschung. Aber dann kommen die Worte „Nicht wie ich will, sondern wie du willst“. Hier bezeugt er wiederum die Menschennatur und den Menschenwillen, aber so wie er vergöttlicht ist durch die Einung mit der Logos-Person, als Wollen des Gottmenschen. Der Spannungsraum bei natürlichen Menschen zwischen Natur und Person ist bei ihm also voll erfüllt mit der göttlichen Person. Als Mensch möchte er das Vorübergehen des Kelches zur Erhaltung des Lebens. Als Gott will er den Tod zur Erlösung der Menschen. Als Gottmensch will er daher gleichfalls den Tod, indem sich sein menschlicher Wille dem Willen des Vaters unterwirft und in Harmonie setzt zu dem göttlichen. Es ist hier also kein Gegensatz, sondern naturgemäße Regung, die alsbald übergeht in die Bereitwilligkeit des Gehorsams. Darüber hinaus geht es Maximus auch darum, die Lehre von zwei Willen in Christus auch philosophisch-spekulativ zu begründen. Seine Darlegungen darüber haben auch einen stark polemischen Charakter, denn sie sind teils direkt, teils indirekt, gegen die Häresie seiner Zeit gerichtet, die einer totalen, geradezu unglaublichen Begriffsverwirrung verfallen war. Deswegen unternimmt er auch hier eine Begriffsanalyse bezüglich der Menschennatur.
Das Hauptbestreben der Vertreter der „Ein-Willen-Lehre“ (Monotheleten) ging dahin, den Willen zu veräußerlichen. ihn vom Innersten des Menschenwesens an die Oberfläche zu verlegen. Sie verwechselten das Willensvermögen mit der Willenstat. Sie sahen in der Willenstat das Wesen des Willens. Demgegenüber unterscheidet Maximus zwischen dem Willen als Naturvermögen, das vorgängig ist, und den Willen als Akt und betont immer wieder, dass der Willensakt nur eine einzelne Äußerung des natürlichen Strebevermögens ist. Den Willen als Vermögen bezeichnet er als Thelema fysikon. Der Wille ist also Sache der Natur. Er ist etwas Angeborenes, nicht etwas Angelerntes, niemand lernt wollen. In den praktischen Lebensvollzügen bedeutet es: man kann wollen, was man will, bloß das Wollen kann man nicht wollen. Das Gewollte ist abhängig von unserem Willen. Absurd ist es geradezu Willensvermögen und Gewolltes zu identifizieren.
Der zweite Begriff, den er eingeführt hat , ist Thelathen und das ist das Objekt des Willens als etwas Äußerliches und tritt nur dadurch zu uns in Beziehung, dass wir unser Wollen auf etwas richten. Thelema und Thelathen sind also die beiden Glieder einer Relation. Die Verbindung beider wird hergestellt durch Thelesis. Diese ist Tätigkeit und Hinbewegen des wollenden Subjektes zum Objekt seines Strebens. Sie verbindet beide, macht sie aber nicht gleich. Das Thelema ist also „das Streben nach dem Naturgemäßen“, nach dem in der Natur einer Sache zu verwirklichenden Sein, darüber hinaus auch das Streben eines Lebewesens nach Selbsterhaltung, nach allseitiger Selbstverwirklichung und Geltendmachung. Aber da der Mensch zu den Vernunftwesen gehört, ist der Wille bei ihm auch das Vermögen zur Selbstbestimmung, die die Freiheit voraussetzt. Die Freiheit ist also seinem Willen eigen, ja sie ist eben sein Wille, oder besser gesagt, sie ist Vollendung seiner Vernunft. Wie es der Pflanze natürlich ist zu wachsen, so ist dem Menschen natürlich, sich frei selbst zu bestimmen. Sie ist auch Forderung seiner Gottebenbildlichkeit, von der in der Genesis 1, 26 die Rede ist. „ Nimm die Freiheit weg, und wir sind nicht mehr Ebenbild Gottes, noch denkende, vernünftige Wesen. Und in Wahrheit, die Natur selbst wird aufgehoben, da sie nicht mehr ist, wie sie sein sollte“, schreibt Maximus in seinen Scholien zu Dionysius.
Nun gibt es verschiedene Formen der Willensfreiheit. Gott besitzt die Freiheit überwesenhaft (hyperousion), so dass es keinen Unterschied zwischen Vermögen und Akt gibt. Hier benutzt Maximus als erster in der christlichen Philosophie das Wort hyperousios, das zum Eckstein für die spätere Seinsphilosophie geworden ist. Die Engel besitzen die Freiheit so, dass das Vermögen immer in Aktivität ist, während beim Menschen ein allmählicher Übergang von der Potenz zum Akt stattfindet. Hier ist der Mensch hineingestellt in den Gegensatz zwischen Gut und Böse und kann sich für dieses oder jenes entscheiden. Die Monotheleten verlegen den Willen und alle Willensentscheidungen in die Person und leugnen damit, dass der Wille etwas Naturgemäßes ist. Dies nennt man heute Personalismus. Die Person ist aber, nach Maximus und der Lehre der Väter, Besitzerin und Verwalterin des Naturwollens und weist seiner Tätigkeit das Ziel. Das Ziel wird durch den Willen angestrebt. Im Mittelpunkt steht die Theorie über das gnomische Wollen im Gegensatz zum Natürlichen. Das Wort „gnome“ hat Maximus von einem Mönch übernommen, dessen Namen er nicht genannt hat. Diese Theorie spielt eine wesentliche Rolle in seinem System. Es gibt nach ihm drei Stufen im Werdeprozess eines Willensentschlusses.
Auf der ersten Stufe ist das Strebevermögen unbewusst oder vor-bewusst, auf der zweiten steht das Erkenntnisvermögen mit seiner Tätigkeit im Vordergrund und auf der dritten kommt es zum Zusammenwirken des Erkennens und Strebens, dessen Resultat das überlegte, bewusste und vernünftige Streben, also das Wollen im eigentlichen Sinne ist. Das Thelema richtet sich über die Thelesis zunächst auf ein undifferenziertes, einzelnes Objekt, ohne Inhalt. Da aber der Wille stets auf ein bestimmtes, erstrebenswertes Ziel, d. h. ein Gut gerichtet ist, wird die Thelesis zu Boule oder Boulesis, d.h. zum überlegten Suchen. Das Suchen und Sich-ausstrecken nach dem Begehrten vermag zwar den erstrebenswerten Gegenstand in Sicht zu bringen, ihn aber noch nicht eindeutig in das ontologische System einzuordnen. So setzt sich das Suchen und Untersuchen zunächst um in ein „Entschlossen-sein zu“ als richtunggebende Gestimmtheit des Herzens, die aber eben soviel von Vorurteilen und vorgefassten Meinungen, wie von objektiven Gegebenheiten des Gegenstandes an sich hat. Diesen Zustand nennt Maximus gnome. Die Gnome ist der Unmittelbare Grund und Ausgangspunkt, woraus der freie Entschluss des Willens aufsteigt – die von Aristoteles genannte Proairesis. Der erste Reflex des Urteils in der begehrenden Seele ist also die Gnome. Aus dem Dargelegten ist ersichtlich, dass die Sünde im Gnomischen liegt. Sie ist ein Fehlgriff der Gnome, ein Abweichen vom Gesetz der Natur, sie ist widernatürlich und gegen die Vernunft. Hier ist der Einfluss der sokratischen Ethik bei Maximus spürbar. Das Natürliche und die Natur stehen nach Maximus nie im Gegensatz zu Gott., wohl aber ist dieser Gegensatz im Gnomischen nicht nur möglich, sondern wird oft auch wirklich.
Die Unterscheidung zwischen dem natürlichen und gnomischen Wollen ist innerlich begründet und auch wesentlich für das Verständnis der Inkarnation. Das natürliche Wollen ist wesentlicher Bestandteil der Natur, findet sich in jedem vernünftigen Wesen, unabhängig davon, ob man das gebraucht oder nicht, ebenso wie das Sprechenkönnen in jedem natürlichen Menschen stets vorhanden ist, auch wenn er schweigt. Das gnomische Wollen hängt vom Gutdünken und Urteil der jeweiligen Person ab. Die Monotheleten verflachen den natürlichen Willen zu etwas bloß Gnomischem. Diesen Irrtum hat Maximus bei ihnen in aller Klarheit erkannt.
Nun zurück zu Christus. Christus besitzt neben dem freien göttlichen auch einen freien menschlichen Willen. Wie kann man aber hier den Widerspruch vermeiden, wenn man einerseits zwei Naturwillen behauptet und andererseits zugleich Einheit der Handlungen in der Person? In geistigen Wesen ist das naturhafte Streben (Thelema fisikon oder Thelesis) immer schon in der Wurzel auch ein geistiges Streben (Thelema logikon). Demzufolge ist die Todesangst Christi ein naturhafter und zugleich ein geistiger Trieb. „Denn notwendig muss zwischen Natur und geistigem Streben Übereinstimmung herrschen, und in der Natur liegt das Bestreben nicht zu sterben, sondern dem Leben anzuhängen“, schreibt er in Opuscula theologica et polemica. Nun wollte aber andererseits der göttliche Wille Christi den Tod. Bestand also hier nicht zwischen den beiden Willen ein Widerspruch? Maximus weist darauf hin, dass es zwei Weisen der Gegensätze (diastolae) im aristotelischen Sinne gibt: den konträren (enantiosis), bei dem sich die Gegensätze nicht ausschließen (wie es z.B. zwischen schwarz und weiß auch Grautöne gibt) und den kontradiktorischen (antikeisthai), wo die Gegensätze sich völlig ausschließen (wie Feuer und Wasser). Der konträre herrscht zwischen Sinnlichkeit und Geist, der kontradiktorische zwischen Leben und Tod.
Nun aber, sagt Maximus, ist es unmöglich, dass zwischen zwei Naturen ein kontradiktorischer Widerspruch besteht, denn alles Naturhafte entstammt einer einzigen gemeinsamen Quelle: Gott. Das Kontradiktorische haftet nur an Eigenschaften der Natur, nicht jedoch an ihrem Wesen selbst. Die Todesfurcht Christi bewegt sich immer noch innerhalb des rein Naturhaften, das von Gott in die Natur gelegt worden ist, wenn auch als Sündenstrafe. Sie ist daher geordnete Furcht. Ungeordnete Furcht dagegen wäre nur auf der Stufe der Gnome möglich. Bei Christus aber ist gnome unmöglich, da sie auf einer Unsicherheit der Ziele und Mittel und daher auf Tasten und Suchen, das auch falsche Wege einschlagen kann, beruht.
Dieses gnomische Wollen, das in besonderer Weise Sache der Person ist, konnte Christus nicht zukommen, da in seiner einzigen göttlichen Hypostase kein Raum für Schwanken und Zögern vorhanden war. Er hatte göttliche Souveränität (autexousion). Die ganze Getriebenheit seines menschlichen Wesens war umgriffen und getragen von der souveränen Freiheit seiner göttlichen Person. In Christus ist mit der unwandelbaren Richtung des Willens auf das Gute absolute Sicherheit des Urteils gepaart, so dass jedes Schwanken in der Entscheidung ausgeschlossen ist. Maximus will ihm aber damit nicht die Fähigkeit eines menschlichen Willensentschlusses absprechen, - dies wurde bereits zur Genüge erörtert, - sondern nur sagen, dass sich bei Christus die Unvollkommenheiten nicht finden, die allen menschlichen Willensentscheidungen anhaften.
Christus ist absolut, nicht nur tatsächlich sündenlos, weil sein menschlicher Wille von der Logosperson getragen ist. Es ist also in Christus nie ein rein menschliches Wollen, es ist immer zugleich göttlich. Die Güte des menschlichen Willens ist deswegen göttlich, weil sie von der Logos-Hypostase getragen wird. Von einem natürlichen Menschen kann man behaupten: wenn er sich in einer Situation für das Gute entscheidet, dann wird er durch diese Entscheidung gut. Für Christus gilt: Er ist absolut gut, darum entscheidet er sich immer für das Gute.
Maximus beschäftigt sich auch mit der Frage, inwieweit Christus auch die Schwächen, Mängel und Gebrechen der Menschennatur angenommen hat. Es geht hier nicht um das Wesen der Natur, sondern um Eigenschaften an ihr. Er bezeichnet sie allgemein als Pathe. Sie stammen sämtlich aus der Erbsünde, tragen aber ganz verschiedenen Charakter. Die einen sind lediglich Strafe, d.h. natürliche Defekte ohne jeden Makel von Sünde oder Schuld, wie z.B. Hunger, Durst, Ermüdung, Leiden, Furcht, Tod. Sie gehören zu physischen Eigenschaften des Menschen, aber nicht zum Wesen der menschlichen Natur, wie es bei Thelema der Fall ist. Sie sind Begleiterscheinungen der Natur, so wie es Leidlosigkeit und Unsterblichkeit vor dem Sündenfall waren. Sie sind natürlich zugleich die Folgen der Erbsünde, sie liegen in der Natur als Kräfte und Triebe und offenbaren sich erst nach dem Sündenfall in solchen Unvollkommenheiten.
Die zweite Klasse der Pathe sind zwar auch Folgen der Sünde, aber sie sind nicht natürlich, sondern widernatürlich wie die Sünde selbst und tragen darum den Schuldcharakter, wie z.B. Unwissenheit, Unsicherheit, Schwanken im Urteil etc., was wir alles bei der Gnome gesehen haben. Des weiteren Auflehnung gegen den Willen Gottes und allgemein Ungehorsam und Unbotmäßigkeit etc. Sie gehen aus denselben Naturkräften hervor wie die ersten, sie treten aber im Gegensatz zu ihnen, in sündhafter Weise auf. Alle diese menschlichen Defekte, die natürlichen wie die sittlichen, hat der Herr auf sich genommen, um alles Unvollkommene und Mangelhafte aus unserer Natur zu entfernen, wie das Feuer das Wachs verzehrt. Er nahm also die natürlichen Folgen der Sünde an, aber er hat sie sich in ganz verschiedener Weise angeeignet.
Es gibt eine doppelte Aneignung: Eine natürliche, indem man die menschliche Natur vollumfänglich annimmt und eine rein äußerliche, indem die aneignende Person sich moralisch mit anderen in ihre Lage versetzt, ohne dass ihr diese Pathe wirklich zukommen. So wie der gesunde Arzt die Leiden der Kranken gleichsam als die seinigen auf sich nimmt und behandelt. Diese äußerliche Aneignung findet, sagt Maximus, bei den sittlichen Mängeln statt. In Wirklichkeit fanden solche Mängel in keinster Weise Eingang bei ihm, denn sie sind auch bei uns nicht natürlich, sondern widernatürlich und gegen die Vernunft. Aber er nimmt sie als Fluch der Sünde freiwillig aus Liebe zu uns auf sich – wegen unserer Erlösung.
Nun zurück zum Monothelethismus. Nachdem der Logos den Menschen als wollendes Wesen erschaffen hat, nachdem er ihm den Willen als einen Wesensbestandteil der menschlichen Natur gegeben hat, musste er notwendig, - wollte er Mensch werden – auch einen menschlichen Willen annehmen. Da die Monophysiten lehrten, dass in Christus nur eine einzige Natur, nämlich die göttliche, wirksam ist, zog der Monotheletismus daraus den Schluss, dass es in Christus nur einen einzigen Willen gibt. Diese Lehre hat aber gefährliche politische Blüten getrieben: Ein Wille, ein Kaiser , ein Reich. Patriarch Sophronius von Konstantinopel vertrat Wesensverschiedenheit der Energien in Christus, die aus der Wesensverschiedenheit der Naturen folgt. Er kämpfte als erster gegen den Monotheletismus. Nach seinem Tod 637, wurde der Monothelet Pyrrhus 638 sein Nachfolger. Papst Johannes IV verurteilte 840 auf einer römischen Synode, von der keine Akten erhalten sind, den Monotheletismus. Um diese Zeit übernimmt Maximus die Führung im monotheletischen Kampf.
Im Juli 645 fand in Karthago die repräsentative Disputation zwischen ihm und Pyrrhus statt, bei der Maximus die ganze Überlegenheit seiner theologischen Erkenntnisse zeigte. In der Disputation machte Pyrrhus geltend, dass die Willen zwar den Naturen entsprechen, aber dass Christus sich die menschliche Natur nur äußerlich angeeignet habe und dass dadurch und deswegen in ihm nur der Wille der göttlichen Person wirke. Maximus hielt gegen diese „personalistische Philosophie“ folgendes fest: Eine geistige Natur definiert sich durch ihre Spontanität (autokineton) und Freiheit (proairesis). Aus der ontologischen Bewegungslehre ist der Satz bekannt: die Dinge sind sich alle darin ähnlich, dass keines das andere ist, und d. h. jedes dem andern unähnlich ist, Dieser „Unterschied ist seinsbegründend und abgrenzend.“
Damit aber diese Grenze auch positive Gründung vom Sein her bedeuten kann, darf sie nicht nur von außen auferlegt sein, sie muss aus dem Seienden selbst als Wirken und Grenzsetzung entströmen. Pyrrhus darf also nicht aus der gemeinsamen Wirkung der Taten Christi auf die naturhafte Einheit schließen. Denn die einheitliche Wirkung hat auch eine doppelte Ursache: Wenn Christus auf dem Wasser schreitet, so ist das Schreiten als solches ein menschliches Tun, das Schreiten auf dem Wasser aber ein übermenschliches. So ist alles, was Christus wirkt menschlich und übermenschlich zugleich. Aber das Übermenschliche in seinem Tun hebt das rein Menschliche nicht auf. Die Göttlichkeit seines Tuns hat ihre letzte Garantie in der unverkürzten und unversehrten Echtheit seiner Menschheit. Gerade sein Reden, Atmen, Hungern, Essen, Trinken, Schlafen, Weinen, Furcht etc. ist der unterscheidende Ort der Erscheinung des Göttlichen. Soweit also die beiden Willen unvermischt sie selber bleiben, können sie sich zu einer Einheit der Tat vereinigen. Diese Einheit ist dann „organische Durchdringung“ (Perichorese).
Für Pyrrhus zählt nur die Person, sie ist eine irrationale Größe jenseits aller Natur. Der Monotheletismus ist sozusagen ein Vorläufer des personalistischen Nominalismus des späten Mittelalters und der Neuzeit, bis in die heutige Zeit. Durch das Leugnen und Nichtbeachten der ontologischen Vorgegebenheiten in der Natur sind auch moderne Strömungen wie „Genderismus“, „Homo-Ehe“, „Ehe für alle“ etc. entstanden. Wenn man die Natur ihrer inneren Dynamik des Strebens zugunsten des personalen Denkens beraubt, so sinkt der Mensch zu einer funktionellen Marionette herab, er wird zum Spielball der herrschenden Ideologie und Politik. Für Maximus dagegen ist die Person die Verwirklichung einer Vernunftnatur und diese Verwirklichung weist auf das Wirklich-machende des Seins, aus dem das Wesen und die innere Wahrheit eines jeden Dinges hervorgeht. So auch nach Thomas von Aquin.
Im Oktober 649 hielt Papst Martin I die Lateransynode ab, zu deren Vorarbeit und Durchführung Maximus mit den griechischen Mönchen in Rom wesentliches beigetragen hat. Hier wurde der Monotheletismus wieder verurteilt. Drei Jahre später, nach dem Sturz des Usurpators Olympius, war die Unionspolitik wieder am Zug und verhaftete Papst Martin I und Maximus. Der Papst wurde nach Cherson am Schwarzen Meer verbannt. Er starb am 26. September 655. Sein Nachfolger war Eugen I, der sich wiederum mit den Kaiserlichen arrangiert hatte. Maximus und seine Gefährten blieben standhaft. Die Klage auf Hochverrat fanden trotz aller Anstrengungen keine sachlichen Unterlagen, so berief man sich auf das zustimmende Verhalten Roms, eine Gemeinsamkeit mit dem Stuhl von Byzanz zu bilden. Maximus durchschaute aber dieses Spiel.
Die Kaiserlichen versuchten nun ihn mit einer Drei-Willen-Lehre auf ihre Seite zu ziehen. Dies soll ein Kompromiss sein, wobei zwei Willen den Naturen zugeschrieben werden und ein Wille der Person. In dem Brief an seinen Schüler Atanasius brandmarkte Maximus diese Ungeheuerlichkeit mit dem Argument, wenn wir zwei Energien (Willen) wegen der Einigung nur eine werden lassen, und sie dann wieder trennen wegen des Unterschiedes, dann heben sie sich auf, und der, dem die zukommen sollen, kann nicht existieren, und so haben wir weder zwei Willen noch einen.
Dieser Brief, nach Rom weitergeleitet, hat den Papst offenbar umgestimmt. Aber Konstantinopel versuchte ihn beim zweiten Verhör in Bizya dazu zu zwingen im Sinne der Kaiserlichen mit Rom zu verhandeln. Maximus blieb aber bei seiner Haltung. Er wird misshandelt, bespuckt, zu einem zweiten Exil nach Mesembria verurteilt. Nach einem letzten Verhör 662 wird er mit seinen Gefährten gegeißelt, man schneidet ihnen die „Lästerzunge“ an der Wurzel sowie die rechte Hand ab, worauf sie in Verbannung geschickt werden. Maximus kommt nach Lazien, an die Ostküste des Schwarzen Meeres, wo er in Einzelhaft gehalten, am 13. August desselben Jahres seinen Leiden erliegt. Er war 82 Jahre alt.
Der hl. Maximus ist nicht für eine Formel oder eine Weltanschauung gestorben, sondern für die Wahrheit. Er hat sein Kreuz nicht aus diplomatischen Gründen abgelegt, um anderen zu gefallen, sondern er hat es auf sich genommen bis zum bitteren Ende.
Hier in diesem Artikel sind lediglich nur einige zentrale Gedanken des Heiligen angeführt worden. Zur Charakterisierung der ganzen Persönlichkeit des hl. Maximus und des Geistes, in dem er lebte, kämpfte und schrieb, zeugt ein Brief von ihm, den ich nach Straubinger zitiere.
„Der ganze Erdkreis und alle Erdenbewohner, die den echten und rechten Glauben an den Herrn haben, blicken unverwandten Auges hin auf die Kirche der Römer und auf ihr Bekenntnis und ihren Glauben wie zur Sonne des ewigen Lichtes, um von ihr zu empfangen den hellen Strahl der überlieferten heiligen Dogmen, wie die gottgeleiteten und gotterleuchteten heiligen sechs Synoden in frommer Weise sie festgelegt haben, deutlich aussprechend den Inhalt des Glaubens. Denn von Anfang an, seitdem der Gott-Logos menschgeworden unter uns wandelte, haben alle christlichen Kirchen allerorts an der hiesigen die einzige unerschütterliche Grundlage (ihrer Rechtgläubigkeit), die nach des Herrn eigener Verheißung niemals überwältigt wird von den Pforten der Hölle, sondern die Schlüssel des rechten Glaubens und Bekenntnisses an ihn hat, die allen, welche in gutem Willen kommen, die Pforte öffnet zur wahren Frömmigkeit, die aber schließt und verstopft den Mund der Häresie, der unrecht spricht in Hochmut. Denn was der Schöpfer des Alls selbst, unser Herr Jesus Christus, was seine Schüler und Apostel, was nach ihnen die hl. Väter und Märtyrer grundgelegt und aufgebaut haben, sich opfernd in Wort und Tat, in Mühen und Kämpfen, in blutigen Leiden und ungerechtem Tod für unsere katholische und apostolische Kirche, das suchen diese durch zwei Worte ohne Anstrengung und Mühe – O Wunder der Geduld und Langmut Gottes! - niederzureißen und das große licht- und ruhmvolle Geheimnis des Christenglaubens zu unterdrücken.“
Benutzte Literatur:
Balthasar, H. U. von: Kosmische Liturgie, Johannes Verlag, 1988
Becker, W: Idealistische und materialistische Dialektik, Verlag W. Kohlhammer GmbH, 1970
Pan-Chiu Lai: Trinitarische Perichorese und Hua-yen Buddhismus, in „Entzogenheit in Gott“, Beiträge zur Rede von der Verborgenh |
|