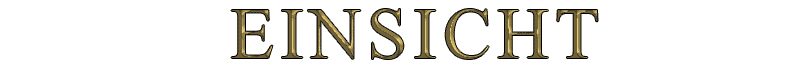Trotzdem Halleluja
Der Romancier Martin Mosebach beklagt,
dass die katholische Kirche ihre schöne, alte Liturgie verloren hat
(aus: DIE WELT vom 21.12.2002
Martin Mosebach wurde 1951 geboren, studierte Rechtswissenschaften und
lebt als freier Schriftsteller in Frankfurt am Main. Zu seinen
bekanntesten Romanen gehören: "Das Bett" (1983); "Die Türkin" (1999);
"Der Nebelfürst" (s. DIE WELT v. 12.1. 2002). Paul Badde hat in Rom mit
ihm gesprochen.
DIE WELT: Das neue Buch des Kleist- und Doderer-Preisträgers Mosebach
ist kein Roman, sondern handelt von der alten Römischen Liturgie.
Martin Mosobach: Die Liturgie ist das öffentliche Gebet der Christen,
die eigentliche Aufgabe der Kirche: für die ganze Welt das Opfer
Christi darzubringen. Aus den Tagen der Apostel in den ersten
Jahrhunderten ist diese Tradition in der römischen Kirche fast
unverändert und unbeinträchtigt in unsere Gegenwart gelangt, bis sie,
als eine der Auswirkungen der Welt-Kulturrevolution von 1968, fast ganz
zerstört wurde.
DIE WELT: Wie kommen Sie als moderner Epiker zu diesem Stoff?
Mosebach: Vielleicht haben wir es mit dem bekannten Phänomen zu tun,
dass Künstler etwas in dem Augenblick erneut zur Kenntnis nehmen, wo es
aufs äußerste gefährdet und fast schon nicht mehr da ist.
DIE WELT: Aber Sie sind doch Schriftsteller und kein Theologe?
Mosebach: Viele Werke der großen europäischen Literatur sind ganz
getragen von der alten Liturgie, von Dantes "Commedia Divina" bis hin
zu den Blasphemien von Rabelais oder Joyce. Doch diese Tatsache berührt
nur die Oberfläche meines Interesses. Und auch die Schönheit der
liturgischen Sprache, die durch banales Plappern abgelöst worden ist,
trifft noch nicht den Kern des Verlustes. Von Anfang an mussten in der
Liturgie ja die drei Sprachen auf jenem Schild des Pilatus vorkommen,
auf dem Jesus am Kreuz lateinisch, griechisch und hebräisch "König der
Juden" genannt wurde. In Restformen wie dem hebräischen "Halleluja"
oder "Amen" bis zu dem griechischen "Kyrie eleison" hat sich das
manchmal noch gehalten. Aber die alte Weltsprache Latein wurde
eliminiert. Es war das Latein des heiligen Hieronymus, das so
eigentümlich naiv und primitiv klingt, weil es der ehrfürchtige Versuch
eines sonst sehr geschliffen schreibenden Mannes war, die Sprache der
Juden im Lateinischen nachzubilden. Dieses Latein des Hieronymus wurde
danach gleichsam zur Mutter aller romanischen Sprachen. Ein großer
kultureller Verlust, aber eben noch nicht der wich-tigste. Denn die
alte römische Liturgie hat der europäischen Kunst ihr eigentliches
Wesen mitgeteilt: Dass sie ein Akt der Verwandlung und Fleischwerdung
war. Dadurch hat sie der europäischen Kunst ihren von jeder anderen
Kunst geschiedenen Anspruch geschenkt, aus Unbelebtem Leben zu
schaffen. Dieser Wille der Maler und Bildhauer, die Materie wirklich zu
durchdringen und zu übernatürlichem Leben zu erwecken, stammt aus der
römischen Liturgie und deren Botschaft: Die gegen-ständliche Welt ist
kein Schein, sie ist kein "Schleier der Maja", sondern in dieser
Materie findet das Heil statt. Das ist die Grundlage für die
schöpferische Energie Europas geworden. Es war das unbedingte
Ernstnehmen der geschaffenen Welt.
DIE WELT: Nun operiert die Liturgie vor allem mit Zeichen, die fast
schon so unverständlich sind wie Chaldäisch. Wer soll das heute noch
begreifen?
Mosebach: Ja, die alte Liturgie stammt wirklich von weit her: Seitdem
hat die Weltgeschichte eine ganze Reihe scharfer Kulturbrüche erlebt.
Es gab schon viele Jahrhunderte, in denen man hätte sagen können: Diese
Liturgie ist unserer Zeit fremd. Das hätte sehr gut der
mittelalterliche Mensch sagen können, und erst recht der
Renaissancemensch. Auch mit dem Barock hatte die Spätantike wenig zu
tun. Dennoch hat sich die alte Liturgie, über die krassesten
Traditionsbrüche hinweg, als lebensfähig erwiesen. Durch die
Jahrtausende war es möglich, den Besitz des Glaubens in dieser Form
weiter zu geben, weil diese Form notwendig war.
DIE WELT: Was soll das heißen?
Mosebach: Christus ist der Mensch gewordene Gott. In der Fleischwerdung
hat Gott gleichsam Form angenommen. Er ist in eine bestimmte
Weltenstunde eingetreten, die von der Tradition als "Fülle der Zeiten"
bezeichnet wird. Die Bedingungen dieser Weltenstunde mussten der alten
Liturgie in der Verschmelzung des jüdischen Offenbarungsglaubens mit
der westlichen Philosophie einen unverwechselbaren Körper geben.
Aufgabe der Kirche ist es, diesen Akt der Inkarnation immer neu
gegenwärtig zu setzen. Die Fleischwerdung Gottes ist kein Mythos. Die
Christen verstehen sie als historisches Ereignis.
DIE WELT: Aber was hat der Bruch mit dieser Gestalt denn verändert - außerhalb der Kirchenmauern?
Mosebach: Die alte Liturgie war ein Instrument, historische
Wirklichkeit gegenwärtig werden zu lassen und damit überhaupt einen
Zugang zur Wirklichkeit zu eröffnen. Wenn ein solches Institut, das
Jahrtausende überdauert hat, plötzlich weg ist, wird man die wahren
Folgen erst nach Generationen überblicken können.
DIE WELT: Wie erklären Sie diesen Verlust?
Mosebach: In der Mitte des letzten Jahrhunderts hatte die Kirche eine
schier unvorstellbare Kraftanstrengung hinter sich. 250 Jahre lang
stand ihr der Wind der Zeit scharf ins Gesicht. Seit Beginn des 18.
Jahrhunderts war sie nur noch in Verteidigungsposition. Der Zeitgeist
war strikt gegen sie. Sie wurde von den intellektuellen Ressourcen
abgeschnitten. Auf die Revolutionen folgten die Enteignungswellen, die
Herausdrängung aus dem laisierten Staat und die Verachtung der meisten
Intellektuellen. Die großen totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts
haben allesamt die Kirche verfolgt. Ein Wunder, dass sie in dieser
ganzen Zeit den Kopf noch auf den Schultern behalten hat. Das ist dann
möglicherweise auch eine Erklärung für das Umfallen in unseren Tagen.
Es war wie bei einem, der sich verkrampft, wenn die Schläge auf ihn
niederprasseln, und erst danach zusammenbricht. Die Kirche hat ihre
Widerstandskraft gegen die moderne Welt verloren, als die schlimmsten
Prüfungen vorbei waren. Vielleicht ist das ist ein Phänomen einer
psychologischen Physik. Aber die Lehmann-Kirche, um das abschätzige
Wort zu gebrauchen, ist gewiss nicht das letzte Wort der
Kirchengeschichte.
***
Leseprobe:
In einer Zeit meines Lebens, in der ich mich viel in Capri aufgehalten
habe, besuchte mich jedes Jahr ein englischer Priester, der in Genua
lebte. Er gehörte zu den Priestern, die man an ihrer Kleidung erkennt
und die auch in Süditalien selten geworden sind. Bei den Geistlichen in
Capri war man von dem Mann in Soutane noch weniger erbaut, als man
hörte, dass er allen Ernstes gedachte, jeden Tag allein eine Heilige
Messe zu zelebrieren, obwohl man seinen religiösen Skrupeln so weit
entgegenzukommen bereit war, dass man ihm anbot, in der Kathedrale an
der Konzelebration teilzunehmen. Der englische Priester war ein sehr
praktischer Mann, kein großer Theologe, aber mit einem ausgeprägten
Sinn für das unmittelbar Notwendige und Naheliegende. Er erhielt
schließlich den Schlüssel zu dem Kapellchen in der Villa Jovis, ein
ferngelegener, ungefährlicher Ort. Da würde er niemanden irritieren. An
einem späten Nachmittag stiegen wir zuerst dort hinauf, einen langen,
beständig leicht ansteigenden Weg über die Höhen mit einem weiten Blick
über den Golf. Oben wollte sich das Schloss nicht drehen lassen, es war
in der hohen Luftfeuchtigkeit der Insel seit dem letzten Jahr
ein-gerostet. Moderluft kam uns entgegen, als die Tür sich dann
öffnete. Die Blechtüre des Tabemakels stand offen. Ein paar schmutzige
Blumenvasen standen auf der Altarplatte, eine Plastikdecke schützte ein
unter ihr verfaulendes Altartuch. Die Kerzen waren heruntergebrannt.
Die Stühle standen unor-dentlich herum. Die Sakristei sah aus, als sei
sie fluchtartig verlassen worden. Leere Flaschen, ein kitschiger Kelch
aus irgendeiner kupfrigen Legierung, Mausefallen, elektrische
Drähte für die all-jährliche Illumination, verkrustete Blumenvasen, ein
Stuhl mit drei Beinen - daraus bestand das Stilleben worauf wir
blickten.
Der Priester öffnete die Schubladen. Von der Feuchtigkeit
zusammengebacken lag da die Altarwäsche und die Alben, ein
schimmelbedecktes zerfallendes Messbuch kam zum Vorschein. Meine Eltern
hatten mir gerade ein altes Messbuch geschenkt, ich wollte gern eines
aus der Zeit des Heiligen römischen Reiches haben, es war von 1805,
also gerade noch richtig in Regensburg herausgegeben, und dies hier war
dieselbe Ausgabe, mit denselben blassen naiven Kupferstichen. Die
Verwahrlosung der Kapelle hatte keinen Charme, dies war kein Pompeji,
sondern ein Müllhaufen, der noch nicht Kompost geworden ist. Üble
Gerüche hingen in der Luft, dies war ein toter Ort.
Mein priesterlicher Freund erlaubte sich keine solchen Reflexionen. Er
hatte etwas vor und verlor keine Zeit. Er öffnete das Fenster, warme
Luft drang ein. Er nahm aus der Ecke einen Strohbesen und begann, die
Sakristei auszufegen. Er wischte die Tischplatte sauber. Er breitete
die Stoffe aus den Schubladen aus und untersuchte sie - sieh da, eine
Albe war sauber und heil geblieben. Er reinigte sorgfältig den Kelch.
Er fand ein verbogenes Kruzifix und stellte es, nachdem er es geküsst
hatte, auf den Sakristeischrank. Er richtete den Altar her, die
Blumenvasen kamen in eine Ecke der Sakristei. Die Stühle standen bald
wieder in einer Reihe. Ein neues Altartuch wurde ausgebreitet. Wir
fanden zwei Kerzen, die auf die hohen Leuchter gesteckt wurden. Als
"Volksaltar" stand da ein mit Holzimitation und metallenen Weintrauben
beklebter Tisch. - "Der gibt eine sehr gute Kredenz", sagte der
Priester, und mit einer Bewegung stellten wir ihn an die rechte Wand.
Er entdeckte das Glockenseil, stellte sich draußen auf die Leiter und
befestigte es an der kleinen Glocke. Jetzt war der Bann gebrochen, die
Trübsalskruste gesprengt. Durch die geöffnete Kirchentür wehte der Wind
wie der Atem, der ein Instrument zum Klingen bringt. Der Priester legte
eine fleckige violette Satinstola um, leerte eine mitgebrachte
Mineralwasserflasche in einen rosa Plastiktopf, begann zu beten, fügte
Salz hinzu, machte die Segensgeste und goss das Wasser in die kleinen
Marmormuscheln neben dem Eingang. Ich glaubte, den Stein in einer Art
Erwachen seufzen zu hören. In der Sakristei lag jetzt ein zerknittertes
Messgewand aus goldenem Lurexgewebe. Ich zog an dem Glockenseil. In der
Abendluft schepperte es dünn, der Wind zerstreute den Klang in alle
Richtungen. Von Ferne näherten sich Leute. Der Glockenklang zog sie an.
Als der Priester aus der Sakristei trat, mit dem zerknitterten
Goldgewand angetan, saßen etwa zwanzig Frauen und Kinder in den Reihen.
Der Priester verneigte sich vor dem Altar und begann zu sprechen:
"Introibo ad altare Dei."
Aus: Martin Mosebach: "Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind." Karolinger, Wien. 157 S.
|